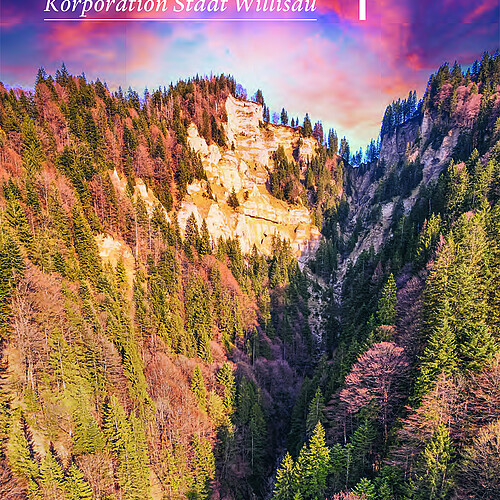- Aktuell
Ein Wald-Mensch-Ansatz in der Wald-Wild-Debatte
Die Wald-Wild-Problematik ist vielmehr eine Wald-Mensch-Problematik. Die menschlichen Aktivitäten und unser Verhalten im Wald sind es, die Wildtiere vermehrt einschränken und zu einem Ungleichgewicht führen. Von den Jägern wird dann erwartet, das Gleichgewicht mit erhöhten Abschussraten wieder herzustellen.
24.04.2025
Meinung
Die Debatte um die Wald-Wild-Problematik in der Schweiz wird immer lauter. Sie konzentriert sich oft auf die Regulierung der Schalenwildbestände durch Bejagung als die vermeintlich einzige Lösung für die hohen Verbiss-, Fege- und Schälschäden, die vor allem durch Hirsch, Gams und Reh verursacht werden. Dadurch steigt der Druck auf die Jägerschaft. Ein wesentlicher Aspekt bleibt dabei unberücksichtigt: der erhebliche Einfluss der menschlichen Freizeitaktivitäten sowie der Land- und Forstwirtschaft auf die Lebensweise der Wildtiere.
Aus der Perspektive eines Wildbiologen, Jägers und Forstingenieures drängt sich für mich die zentrale Frage auf, wieso das Schalenwild diese Schäden verursacht und was wir tun können, um sie zu reduzieren? Die Regulierung der Bestände durch Bejagung mag technisch gesehen die einfachste Lösung sein, aber sie ist nicht nachhaltig. Denn je mehr menschliche Aktivitäten den Wald beeinflussen, desto grösser wird der Jagddruck, um das Gleichgewicht zu erhalten. Es geht vielmehr darum, die tiefer liegenden Ursachen der Verbissschäden zu verstehen und Lösungen zu finden, die über die Bejagung hinausgehen.
Lebenszyklus und Verhalten von Schalenwild
Um die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf Wildtiere zu verstehen, ist es wichtig, das natürliche Verhalten und die Bedürfnisse des Schalenwilds zu betrachten. Beim sogenannten Äsungszyklus wechseln sich Phasen des Fressens mit Phasen des Wiederkäuens ab. Ein Reh ist beispielsweise darauf angewiesen, bis zu zwölfmal täglich Nahrung aufzunehmen und sie in den Ruhephasen zu verdauen (Baumann et al 2019). Die Ruhephasen sind entscheidend für die Verdauung und Energiegewinnung. Ständige Störungen und Fluchtbewegungen beeinträchtigen den Äsungszyklus erheblich. Oft ist das Schalenwild gezwungen, im Wald zu bleiben und dort zu äsen.
Menschliche Aktivitäten im Wald und ihre Folgen für Wildtiere
Wenn menschliche Freizeitaktivitäten im Wald, in Schutzgebieten und im Naherholungsraum von Städten zunehmen, wird es für Wildtiere immer schwieriger, sich natürlich zu verhalten und zu ernähren (Graf et al 2018, Peters et al 2022). Eine Folge der Störungen kann die Verschiebung der Aktivitäten in die Nacht sein. Solche Reaktionen können Folgen für die Fitness, das Überleben von Populationen, die Interaktionen in der Gemeinschaft und die Evolution haben (Gaynor et al 2016). Viele Menschen sind sich der Auswirkungen ihrer Präsenz auf das Wild nicht bewusst. Insbesondere Reh und Rothirsch im winterlichen «Energiesparmodus» reagieren empfindlich auf Störungen. Flucht und der Wechsel in einen aktiveren Modus kosten viel Energie. Den Verlust müssen die Tiere mit zusätzlicher Nahrung kompensieren. Häufig stehen dafür nur Knospen und Triebe junger Bäume zur Verfügung (Geyer et al 2021).
Nachfolgend typische menschliche Aktivitäten mit Auswirkungen auf das Verhalten der Wildtiere in der Schweiz (Ingold 2005, freizeitwald.ch1):
- Wandern, Mountainbiken und Outdoor-Übernachtungen stören das Wild durch Geräusche, Bewegungen und Lichtverschmutzung und schränken seinen natürlichen Lebensraum ein. Abseits der markierten Wege und in Gebirgslagen verursachen sie zusätzlich unnatürliches Fluchtverhalten.
- Skifahren und Wintersport stören Wildtiere in der kalten Jahreszeit. Um den Energieverlust zu kompensieren, verlegen sie die Nahrungssuche vermehrt in den Wald.
- Der Joggingsport verursacht permanente Störungen, vor allem wenn Menschen mit Stirnlampen in der Dämmerung durch den Wald laufen, wenn viele Wildtiere auf Nahrungssuche sind. Die Verschiebung der Nahrungssuche in die Nacht erschwert auch die Bejagung.
- Zunehmende Flugbewegungen sind eine ernste Bedrohung für das Wild. Unerwartet auftauchende Gleitschirme können Tiere in Panik versetzen und zwingen, gewohnte Ruhe- und Fressgebiete zu verlassen. Dadurch verlieren sie ihre Nahrungsgrundlage und wichtige Rückzugsorte.
- Die steigende Anzahl von Herdenschutzhunden ist ein neuer Stressfaktor. Ihre Präsenz führt dazu, dass weite Gebiete für Wildtiere «tot» sind, da sie die Hunde auch ohne direkten Kontakt als Bedrohung wahrnehmen.
- Die Land- und die Forstwirtschaft können das Habitat und die Nahrungsverfügbarkeit der Wildtiere verbessern oder verschlechtern. Offene Flächen und verjüngte Waldgebiete können mehr Nahrung und/oder Verstecke bieten, Monokulturen und intensiv gemähte oder beweidete Wiesen (Abbildung 1) verändern die Artenzusammensetzung und verringern die Verfügbarkeit natürlicher Futterquellen. Solche Veränderungen können die Tiere in Waldgebiete verdrängen und zu mehr Wildschäden führen.

Praxisrelevanz der Wald-Wild-Forschung
Die Forschung muss Lösungen entwickeln, die den realen Herausforderungen der Wald-Mensch-Problematik gerecht werden. Viele wissenschaftliche Arbeiten haben eine unklare Praxisrelevanz. Es existieren zahlreiche Studien zu Intensität, Saisonalität und ökonomischer Auswirkung der Wildschäden (Clasen et al 2017, Kupferschmid et al 2023). Auch wenn intensiv an die Vereinheitlichung der Methoden zur Abschätzung von Verbissschäden gearbeitet wird (Fehr et al 2019; Kupferschmid et al 2019; Rüegg et al 2010), bleibt die Frage: Welche Massnahmen sind notwendig, wenn Schäden festgestellt wurden?
Für das Bundesamt für Umwelt ist neben der jagdlichen Regulierung auch die Verbesserung des Lebensraums wichtig (BAFU 2010) – etwa in Form von mehr ungestörtem Raum für Rothirsche in den Tageseinständen im Wald und mit einem guten Angebot an Deckung und angrenzenden Äsungsmöglichkeiten. Praxisorientierte Forschung sollte helfen, diese Empfehlungen umzusetzen. Es wäre beispielsweise sinnvoll, auf Grosswiesen zu untersuchen, ob Schutzstreifen mit geeigneter Vegetation entlang der Waldränder dem Wild tagsüber eine ungestörte Äsung ermöglichen. Gleichzeitig könnten solche Schutzstreifen dazu beitragen, die Bejagung effizienter zu gestalten. Würden die Landwirte in relevanten Gebieten (z.B. Wintereinstände des Hirschs) die letzten Schnitte im Herbst auslassen oder die Kühe früher ins Tal bringen, könnte sich das Schalenwild besser auf den Winter vorbereiten und hätte nach Schneeausaperung altes Gras zur Verfügung. Eine angepasste Wanderwegnetzdichte insbesondere in Naherholungsgebieten würde grössere störungsarme Räume schaffen (Abbildung 2).

Gemeinsamer Dialog als Schlüssel
Es reicht nicht aus, nur die Wildbestände zu regulieren – wir müssen auch die Art und Weise, wie wir die Natur nutzen, hinterfragen. Wildruhezonen mit Einschränkung der Freizeitaktivitäten, Aufklärung der Öffentlichkeit über die Folgen ihres Verhaltens und eine auf die biologischen Bedürfnisse des Wildes abgestimmte integrale räumliche Planung der Infrastruktur sowie der Land- und Forstbewirtschaftung könnten Schritte in die richtige Richtung sein. Wildhüterinnen und Förster, Jägerverbände, Gemeinden und die Ämter für Jagd sind in den Dialog einzubeziehen. Besonders die Erfahrung von Jägerinnen und Wildhütern, die das Verhalten des Wildes kennen, sollte berücksichtigt werden. Langfristig ist ein komplexes Wildmanagement zur Wald-Mensch-Problematik zu entwickeln, das situationsgerechte Massnahmen vorschlägt, um artgerechte Lebensräume für Wildtiere zu schaffen.
Ivan Nikolov, nikolov.i@wildlife-mediators.ch
Schweiz Z Forstwesen 176 (3): 176–177.
Wald und Wild – Grundlagen für die Praxis. Wissenschaftliche und methodische Grundlagen zum integralen Management von Reh, Gämse, Rothirsch und ihrem Lebensraum. Umwelt-Wissen Nr. 1013. Bern: Bundesamt für Umwelt. 232 S.
Jagen in der Schweiz: auf dem Weg zur Jagdprüfung. Bern: Ott Verlag. 368 S.
Die Berücksichtigung von Risiken durch den Verlust von Mischbaumarten. Ökojagd 1: 12–19
Gutachtliche Beurteilung des Wildeinflusses auf die Waldverjüngung. Schweiz Z Forstwes 170: 135–141. doi:https://doi.org/10.3188/szf.2019.0135.
The influence of human disturbance on wildlife nocturnality. Science 360: 1232–1235. doi:https://doi.org/10.1126/science.aar712
Praxis-Ratgeber Waldumbau und Jagd. Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Freiburg i.Br., 94 S.
Wildtier und Mensch im Naherholungsraum. Swiss Academies Factsheets 13 (2). doi:https://doi.org/10.5281/ZENODO.1168451
Freizeitaktivitäten im Lebensraum der Alpentiere. Bern: Haupt. 516 S.
Abschätzung des Einflusses von Verbiss durch wildlebende Huftiere auf die Baumverjüngung. Schweiz Z Forstwes 170 (3): 125-134. doi:https://doi.org/10.3188/szf.2019.0125
Häufigkeit von Fege- und Schlagspuren inner- und ausserhalb der Tageseinstände von Rothirschen im Berner Mittelland. Schweiz Z Forstwes 174 (5): 288-295. doi:https://doi.org/10.3188/szf.2023.0288
Methoden zur Erhebung und Beurteilung des Wildeinflusses auf die Waldverjüngung. In: BAFU (ed.) Wald und Wild – Grundlagen für die Praxis. Wissenschaftliche und methodische Grundlagen zum integralen Management von Reh, Gämse und Rothirsch und ihrem Lebensraum. Bern: Bundesamt für Umwelt. pp. 67–91.
https://www.freizeitwald.ch/de/waldbesuch/wechselwirkungen/auswirkungen-auf-die-umwelt(abgerufen am 27.11.2024)