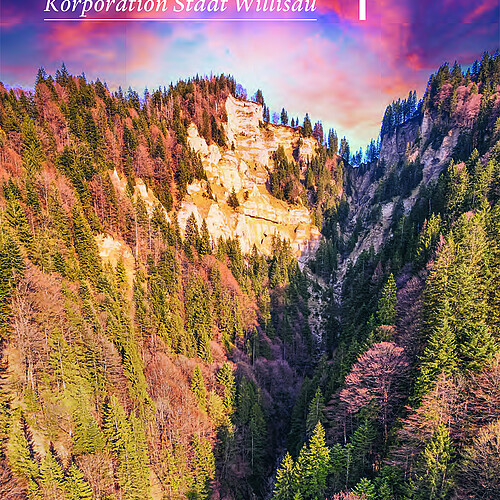- Aktuell
Interview Rolf Holderegger: «Ich wünsche mir, dass wir den Wald nicht monothematisch betrachten»
Seit Herbst 2024 ist Rolf Holderegger Direktor der der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Im Interview äussert er sich über den jüngst erschienenen dritten Waldbericht, die Zukunft der WSL im ETH-Bereich und seine Erwartungen an den Schweizerischen Forstverein.
24.04.2025
Interview
Schweiz Z Forstwesen 176 (3): 178
Rolf Holderegger, wie geht es Ihnen nach der Präsentation der Resultate des dritten Waldberichts?
Mir persönlich geht es gut. Aber natürlich macht mich die Situation des Waldes betroffen. Er steckt nicht in einer generellen Krise. Weil sich aber verschiedene Herausforderungen überlagern können, erscheint die Situation an gewissen Orten kritisch. Also müssen wir genau hinschauen. Es ist gut, dass nach 2005 und 2015 nun eine dritte Gesamtschau des Waldes vorliegt. Der Waldbericht stärkt die Übersicht und das Zusammenwirken unterschiedlicher Kreise, Fachgebiete und Interessengruppen.

Welches sind die Haupttreiber der grossen Veränderungen im Wald?
Der Klimawandel in allen seinen Facetten und mit allen seinen Auswirkungen ist der dominierende Treiber. Die Folgen des Klimawandels sind sichtbar. Nicht nur im Waldbericht sehen wir, dass sich Extremereignisse häufen und die Zahl von Trockenjahren zunimmt wie etwa 2015, 2018, und 2022: Die Erholungszeit bleibt aus, Bäume werden geschwächt. Kommen Stürme und Käferbefall dazu, haben wir mehrere Probleme auf einen Schlag. Das kann lokal dramatisch werden.
Sie sehen aber auch positive Veränderungen.
Wir dokumentieren mehr Totholz und sehen eine Zunahme der Biodiversität. Ich finde, dass wir in der Schweiz dank naturnahem Waldbau, der kontinuierlich nur kleine «Störungen» mit sich bringt, in einer guten Position sind. Zudem sind die Wälder vergleichsweise alt und resilient, und die Baumartenvielfalt ist hoch. Die Naturverjüngung beträgt rund 90%. Auch deshalb ist der Schweizer Wald eine Kohlenstoffsenke, was anderswo in Europa nicht mehr der Fall ist: Die Schweiz ist Europameisterin, was die Einlagerung von Kohlenstoff im Waldboden betrifft.
Ich finde, dass wir in der Schweiz dank naturnahem Waldbau, der kontinuierlich nur kleine «Störungen» mit sich bringt, in einer guten Position sind.
Wo sehen Sie den grössten Handlungsbedarf?
Die Schweiz und die Forstdienste auf allen Ebenen sind auf gutem Weg. Wir können auch stolz sein auf das Erreichte. Sicher müssen wir das Baumartenportfolio anpassen, wo nötig. Aufholen können wir in der Kaskadennutzung des Holzes: Wir müssen Holz als langfristigen Bau- und Werkstoff und nicht nur als Energieträger verwenden. Hier geht die Entwicklung derzeit in die Gegenrichtung. Ganz persönlich finde ich, dass wir auf die Praktikerinnen und Praktiker setzen müssen. Wir brauchen Fachleute draussen, die wenn immer möglich grössere Waldeinheiten mit den passenden Eingriffen fit für die Zukunft machen. Mit einer wissenschaftlichen Begleitung, wie sie die WSL bietet, können wir das Wissen und die Erfahrungen daraus dokumentieren, auswerten und teilen.
Wissensaustausch steht also weit oben auf der Prioritätenliste?
Ja, für alle Beteiligten ist der Austausch zentral. Jeder Förster sieht vorerst einmal den eigenen Wald und darin viele Details. 15 bis 20 Försterinnen kennen zusammen viele Wälder. Wir Forschende können Wirkungsmechanismen und den Überblick beitragen, müssen dafür jedoch wissen, welche Probleme die Praxis beschäftigen. Auch die Angebote der Forschung sind nicht allen bekannt. Eine Befragung zeigte, dass die bestehenden Tagesseminare, Fachexkursionen und seit Corona auch Webinare geschätzt werden. Wir müssen uns nicht neu erfinden.
Wie lässt sich der Austausch weiter verbessern?
Insbesondere wir Forschende sollten vermehrt in bestehende Gremien Einsitz nehmen, uns engagieren und in direkten Austausch treten. Für viele jüngere Forschende an der WSL ist es ein wichtiger Antrieb, dass ihre Arbeit Wirkung hat. Gleichzeitig soll die WSL im ETH-Bereich auch exzellente Forschung hervorbringen. Wir sind gefordert.
Und die finanziellen Rahmenbedingungen machen die Arbeit nicht leichter.
Sicher ist Angst ein schlechter Ratgeber, gerade auch, wenn es um Kürzungen geht. Aktuell müssen wir rund 30 Stellen einsparen. Wir planen, den Abbau über Pensionierungen aufzufangen. Trotzdem geht Arbeitskraft verloren, was längerfristig spürbar wird. Ein Ausweg aus dem Dilemma sehe ich in Optimierungen und mehr Zusammenarbeit.
Welche Rolle sollte der Schweizerische Forstverein einnehmen?
Ich hege grosse Sympathien für Fachgemeinschaften. Mit dem Schweizerischen Forstverein sollten wir den Austausch intensivieren, nicht zuletzt auch mit einer Vertreterin im Vorstand. Diskussionen bringen uns alle weiter, das gilt besonders für das Engagement der Arbeitsgruppen des Forstvereins oder die thematischen Sondernummern der SZF. Mit der Zeitschrift erreichen wir mit wissenschaftlichen und praxisnahen Artikeln Forstfachleute in Entscheidungsfunktionen. Über Publikationen anderer Institutionen wie etwa «WALD und HOLZ» und den Zeitschriften «Berner Wald», «Zürcher Wald» und «Bündner Wald» erreichen wir auch Revierförsterinnen und Forstwarte. Der Forstverein ermöglicht mit der Nähe zu den Kantonen und zur Verwaltung einen wichtigen Austausch mit Schaltstellen.
Der Forstverein soll der Ort sein, wo diskutiert wird.
Wo sehen Sie weiteres Entwicklungspotenzial für den Forstverein?
Persönlich finde ich, dass es mehr kontroverse Diskussionen geben sollte. Welche Bedeutung haben waldbauliche Entscheidungen, und welche Auswirkungen haben sie nicht zuletzt auf die Kosten? Der Forstverein soll der Ort sein, wo diskutiert wird.
Welche drei Wünsche hätten Sie an die gute Fee?
(überlegt) Zuerst eine offene Diskussionskultur, wo auch Kontroversen Platz haben. Zweitens, dass wir mit allen kommunizieren können, die sich um Waldanliegen kümmern. Und schliesslich wünsche ich mir, dass wir vernachlässigte Themen nicht vergessen. Am Herzen liegen mir persönlich etwas die Wiedervernässung von Wäldern oder die Erhaltung von Auenwäldern. Was passiert genau, wenn wir die Esche verlieren oder Flussrenaturierungen oft auf Kosten der Hartholzauenwälder gehen? Hätte ich einen vierten Wunsch, so wäre der, dass wir den Wald nicht monothematisch betrachten. Diese Zeiten sind vorbei. Der Wald hat viele Funktionen, und jeder Entscheid hat überall Auswirkungen.
Interview: This Rutishauser
Ökologe und Direktor

Rolf Holderegger (60) ist seit einem guten halben Jahr Direktor der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Der studierte Biologe war Gymnasiallehrer, Berater im Bereich Naturschutz und stellvertretender Leiter der Abteilung Ökologische Genetik sowie Leiter der Forschungseinheiten Ökologische Genetik und Evolution und Biodiversität und Naturschutzbiologie an der WSL. Seit 2023 ist Rolf Holderegger ausserdem Leiter des Synthesezentrums Biodiversität, das Brücken zwischen Forschung und Anwendung baut.
3. Waldbericht
Wie geht es unserem Wald? Der dritte Waldbericht liefert Antworten mit umfassenden Einblicken in Zustand, Entwicklung und Zukunft unserer Wälder. Herausgegeben vom Bundesamt für Umwelt BAFU und der WSL, ist der Waldbericht eine Gesamtschau über die letzten zehn Jahren und gibt einen Ausblick für die sechs Themenbereiche Ressourcen, Gesundheit und Vitalität, Waldnutzung, Biodiversität, Schutzwald und Sozioökonomie im Hinblick auf den fortschreitenden Klimawandel. Rund 90 Expertinnen und Experten haben die Informationen aus einer Vielzahl von Langzeitbeobachtungen gesammelt und fachkundig interpretiert, um die relevanten Fragestellungen zu beantworten.