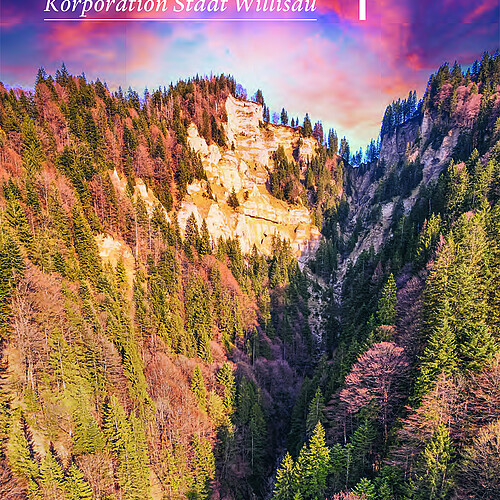- Aktuell
Lebensraumförderung im Wald: aktiv oder passiv, integrativ oder segregativ
An einer Weiterbildung der SFV-Arbeitsgruppen «Wald und Wildtiere» und «Waldbiodiversität» beleuchteten Fachleute aus der Verwaltung, der Forschung und dem Forstsektor unterschiedliche Wege zur Aufwertung von Lebensräumen für Wildtiere im Wald.
24.04.2025
Tagungsbericht
Schweiz Z Forstwesen 176 (3): 183
Die von den Arbeitsgruppen «Wald und Wildtiere» und «Waldbiodiversität» des Schweizerischen Forstvereins gemeinsam organisierten Weiterbildungen am 22. Januar in Chur und am 23. Januar in Grangeneuve bei Posieux drehten sich um die Lebensraumförderung von Wildtieren im Wald. Insgesamt nahmen knapp 200 Personen aus Forstbetrieben, Jagdkreisen, Naturschutzpraxis, Verwaltung und Forschung teil.

selten gewordene Arten. Die Aktivitäten des Bibers können durch verschiedene Massnahmen in die bestehende Infrastruktur integriert werden. Herzogenbuchsee (BE).
Beiträge des Bundes, der Kantone und der Forschung zeigten die Strategien und Instrumente zur Lebensraum- und Artenförderung auf und thematisierten Defizite in der Vernetzung oder der Verfügbarkeit von Totholzhabitaten. Zentrale Fragen waren, welche Arten und Lebensräume am besten mit natürlich ablaufenden Prozessen gefördert werden und wo aktive Eingriffe nötig und gerechtfertigt sind. In einer Umfrage erachtete die Mehrheit der Teilnehmenden beides als notwendig.
Beispiele aus dem Kanton Jura zeigten die Unberechenbarkeit von auf einzelne Arten zugeschnittenen Förderungsmassnahmen. Auf Auflichtungsflächen für den Gelbringfalter starben in den trockenen und heissen Sommern die Buchen ab. Nun sind die Flächen für den seltenen Falter zu offen. Dafür profitiert nun die stark gefährdete Aspisviper von intensiv besonnten Flächen.
Wenn von natürlichen Prozessen und Störungen die Rede ist, darf der Biber nicht fehlen. Die wachsende Population schuf mit der Stauung kleiner Flüsse und Bäche bereits zahlreiche Wasser- und Sumpflebensräume mit Totholz, Sand- und Kiesbänken. Der Biber ist damit ein effektives – wenn auch unberechenbares – Werkzeug bei der Renaturierung von grossen Flächen, die meist konfliktfrei erfolgt. Welche Massnahmen im Konfliktfall vorgesehen sind, wurde anhand von Beispielen diskutiert.
Integrativer Ansatz fördert Waldbiodiversität in Schutzwäldern
Erfahrungen aus dem Kanton Graubünden zeigen, wie man mit einem integrativen Ansatz Waldbiodiversität in Schutzwäldern fördern kann. Sonderwaldreservate zugunsten des Auerhuhns, aber auch Naturwaldreservate können in Schutzwälder integriert werden. Ohne die Integration von Massnahmen im Schutzwald wäre eine gezielte Lebensraumförderung auf zwei Drittel der Waldfläche des Kantons nicht möglich. Ein Förderprojekt für die Wasserfledermaus zeigte, wie kleine Aufwertungen im Wirtschaftswald Lebensraum für Fledermäuse schaffen können.
In Vorträgen stellten Forstbetriebe, Jagdgesellschaften und Naturschutzorganisationen konkrete Beispiele vor. Für verschiedene Forstbetriebe ist die Umsetzung von Massnahmen zur Lebensraumaufwertung ein wichtiges Standbein geworden, in das gezielt investiert wird. Der Forstbetrieb Homberg-Schenkenberg im Aargau pflegt lichte Waldstrukturen mit geeigneten Maschinen, mit Handarbeit und in Koordination mit Landwirtschaftsbetrieben, die einzelne Flächen extensiv beweiden. Der Unterhalt von ökologisch wertvollen Lebensräumen ist zu einem wichtigen Betriebszweig mit spezialisiertem Maschinenpark geworden.
Wissensaustausch ist zentral
Die Beiträge zeigten, dass es für viele Artengruppen und Lebensräume geeignete Fördermassnahmen gibt und viel Erfahrung mit der Umsetzung vorhanden ist. Zentral ist, dass das Wissen und die Erfahrungen zwischen den Akteuren und (Sprach-)Regionen ausgetauscht wird. In mehreren kurzen Umfragen beurteilten die Teilnehmenden den Handlungsbedarf bei der Zusammenarbeit, beim Prozessschutz und bei der Förderung von Lebensräumen als sehr hoch.

Florian Walter, Christof Gantner