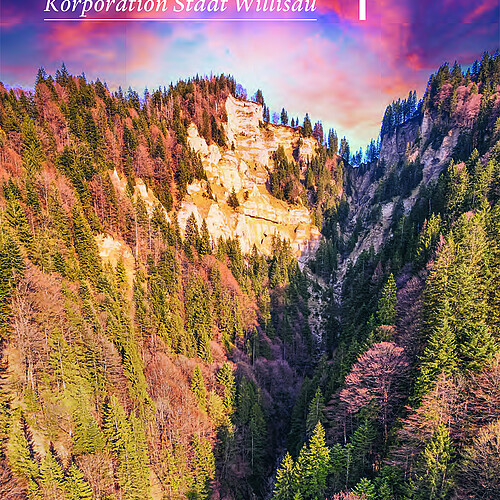- Aktuell
Methoden bei der Wiederherstellung von Wäldern
Um die Regeneration von Wäldern zu beschleunigen, haben Studierende gemeinsam mit der Gruppe Restoration Ecology des Crowther Labs innovative Strategien auf das grösste Potenzial für eine breitere Anwendung untersucht.
01.11.2024
Wald + Landschaft an der ETHZ · Forêt + paysage à l’EPFZ
Die Wiederherstellung von Wäldern birgt ein enormes Potenzial, um den globalen Bedrohungen (z.B. Verlust der biologischen Vielfalt und Ernährungsunsicherheit, Pandemien, Klimawandel) zu begegnen. In einem Übersichtsartikel hat das Crowther Lab 143 Studien analysiert und sieben Innovationen im Bereich der unterstützten Regeneration zu identifiziert. Die ausgewählten Methoden waren auf lokaler Ebene erfolgreich und haben das Potenzial für eine breitere Anwendung.

In Zusammenarbeit mit Studierenden der ETH Zürich, die sich mit der Erhaltung und Wiederherstellung von Ökosystemen befassen, untersuchte das Crowther Lab, wie die einzelnen Strategien die Wiederherstellung von Wäldern, Waldgebieten und Mangroven fördern. Die Studierenden erstellten eine erste Literaturübersicht mit Vor- und Nachteilen ausgewählter Methoden.
Immer Kompromisse
Alle Innovationen sind bei der Anwendung mit Kompromissen verbunden. Mischpflanzungen mit einer grossen Vielfalt einheimischer Arten führen im Allgemeinen zu widerstandsfähigeren Ökosystemen. Dieser Ansatz kann jedoch durch die Verfügbarkeit von Arten und die mit der Beschaffung und Vermehrung einer Vielzahl einheimischer Pflanzen verbundenen Kosten eingeschränkt werden.
Die Integration wirtschaftlich wertvoller Arten (z.B. schnell wachsende Baumarten) kann durch deren Verkauf die anfänglichen Kosten der Regeneration ausgleichen. Dieser Ansatz kann jedoch die Erholung der einheimischen Artenvielfalt verlangsamen und die langfristigen Regenerationsziele behindern.
Räumlich strukturierte Pflanzungen (z.B. Gruppenpflanzung, bei der Bäume in Gruppen und nicht flächig gepflanzt werden) senken die Kosten und können zu einer schnelleren Erholung der biologischen Vielfalt führen. Nicht immer kommt es dabei zu einer raschen Akkumulierung von Biomasse oder Kohlenstoffbindung im Vergleich zu traditionelleren Bepflanzungsansätzen.
Alternative Wiederbegrünungsmethoden (Direktsaat oder die Verwendung von Stecklingen) sind im Allgemeinen kosteneffizienter als die traditionelle Pflanzung von Setzlingen. Allerdings sind sie oft mit einer höheren Sterblichkeitsrate und einem langsameren Wachstum verbunden. Dieser Ansatz könnte kurzfristig wirtschaftlich attraktiv sein, aber mehr Pflege oder zusätzliche Pflanzungen erfordern, um langfristige Regenerationsziele zu erreichen.
Die Zugabe von Bodenmikrobiomen kann das Pflanzenwachstum und die Erholung des Ökosystems erheblich verbessern, insbesondere in geschädigten Böden. Die Gewinnung und Einbringung dieser Mikrobiome ohne Schädigung der Spenderökosysteme ist jedoch eine Herausforderung, da die Gefahr besteht, dass Pathogene oder invasive Mikroorganismen eingeführt werden.
Schliesslich kann die Verwendung von Bioabfällen und Biokohle die Bodenfruchtbarkeit und das Pflanzenwachstum verbessern und damit möglicherweise die Regeneration beschleunigen (Abbildung 1). Diese Ansätze können jedoch teuer sein, insbesondere in Gebieten, die weit von Bioabfallquellen oder Biokohleproduktionsanlagen entfernt sind. Möglich ist auch die Verringerung des Überlebens von Pflanzen durch unbeabsichtigte Veränderungen der Bodenchemie.
Abhängig von ökologischem oder sozioökonomischem Kontext
Viele der diskutierten Innovationen sind stark kontextabhängig. Was in einem ökologischen oder sozioökonomischen Kontext gut funktioniert, ist in einem anderen möglicherweise nicht so effektiv. Dies hemmt die weltweite Verbreitung. Trotzdem sind viele Instrumente vorhanden, um die terrestrische Regeneration voranzutreiben. Mit unseren Studierenden untersuchen und diskutieren wir die Bandbreite der Ergebnisse, die in der ganzen Welt erzielt wurden.
Leland Werden, lelandkendall.werden@usys.ethz.ch, Ian Brettell, ian.brettell@usys.ethz.ch
Schweiz Z Forstwesen 175 (6): 322
Assessing innovations for upscaling forest landscape restoration. One Earth 7 (9): 1515–1528. doi: 10.1016/j.oneear.2024.07.011