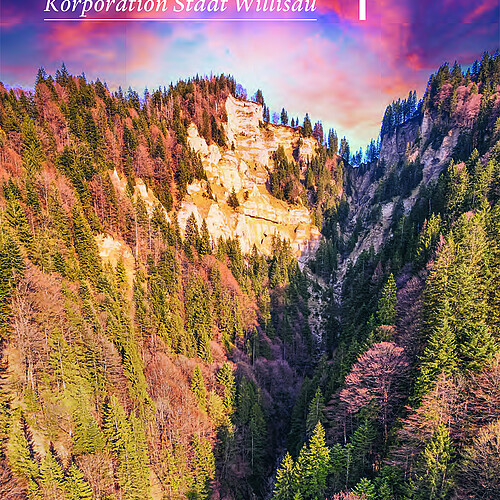- Aktuell
Viele Ansprüche und schnelle Veränderungen führen zu grossen Diskussionen
Soll im Wald Windenergie produziert werden? Und wenn ja: Wo? Dazu diskutierten Exponentinnen und Exponenten mit unterschiedlichsten Positionen im Rahmen des SFV-Fachseminars «Gefährdet die Energiepolitik die Waldleistungen? Erneuerbare Energien: Was auf dem Spiel steht».
01.11.2024
Forstverein · Société forestière
Der Wald steht unter Druck. Es gibt unterschiedliche Forderungen an die Waldnutzung. Auch geniessen Klimaschutz und die Förderung der erneuerbaren Energien gegenwärtig einen hohen Stellenwert. Dass die Herausforderungen gross sind, bestritt niemand der rund 80 Anwesenden am Fachseminar des Schweizerischen Forstvereins (SFV) (Abbildung 1). Windkraftanlagen stehen im Widerspruch zu den Zielen der Walderhaltung. Die Lösungswege für den Umgang mit zahlreichen Zielkonflikten sind aber umstritten, wie die engagierten Diskussionen zeigten.
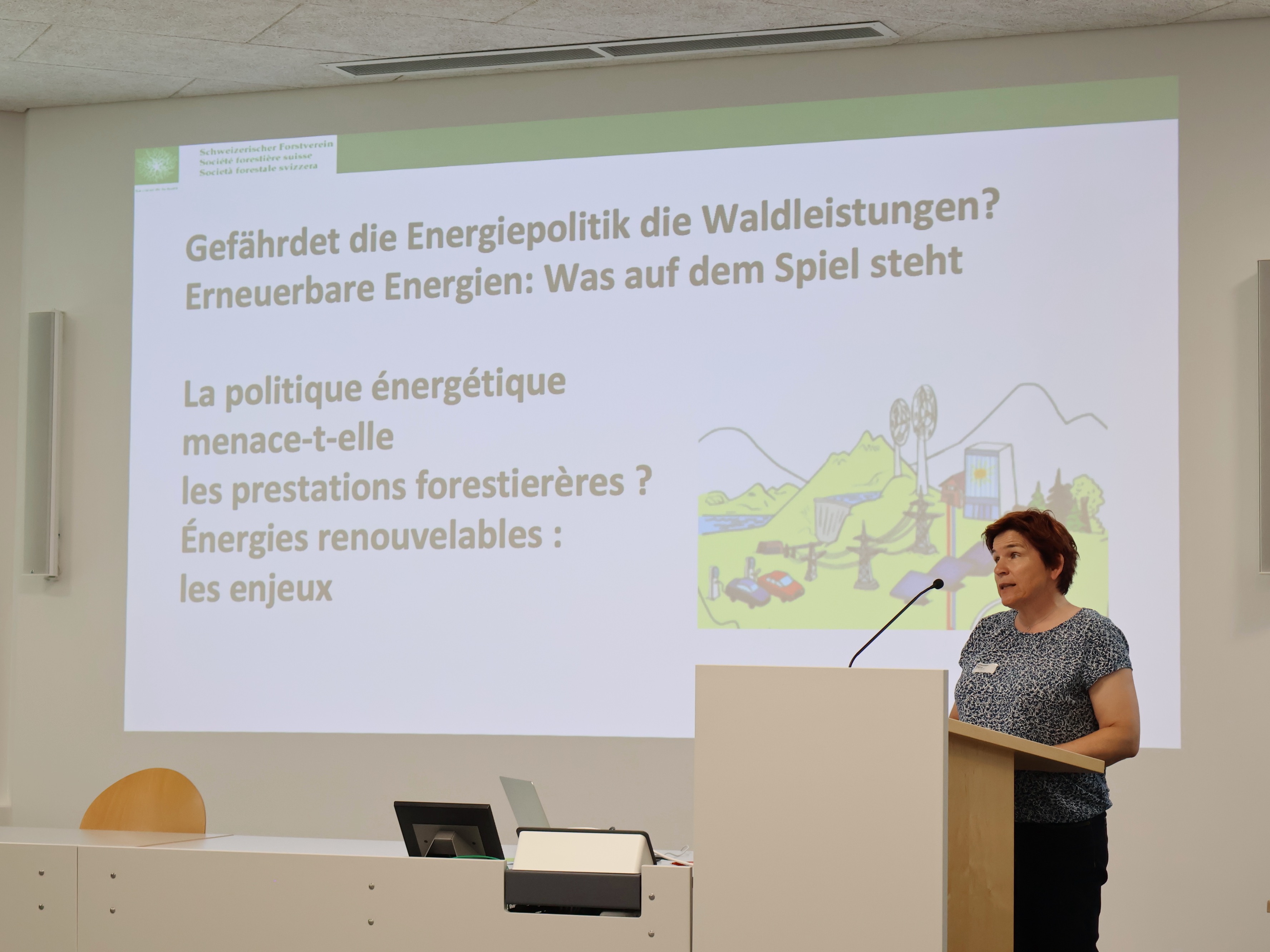
Einführend lieferten Referate, die alle in der SZF 4/2024 publiziert sind, fachliche Inputs für das nachfolgende Podiumsgespräch. Adrienne Grêt-Regamey, Professorin am Lehrstuhl Planung von Landschaften und Umweltsystemen (PLUS) der ETH Zürich, präsentierte Modellrechnungen zum Spannungsfeld der vielen Ansprüche für die Schweiz. Explizit suchte sie mit ihrem Forschungsteam nach den besten Standorten für die Produktion erneuerbarer Energie unter Berücksichtigung von Schutzstatus, Präferenzen aus Bevölkerungsumfragen und unterschiedlichen Strategien (z.B. Energieeffizienz, Erhalt von Ökosystemleistungen, Vermeidung sozialer Konflikte) (Abbildung 2). Die Modellierungen zeigen, dass es aus Sicht der Bevölkerung keine «ideale» Energielandschaft gibt, aber solche, die besser sind als andere. Mehrere Befragungen förderten zutage, dass unberührte Alpenlandschaften zwar tabu bleiben, aber die Akzeptanz von Energieanlagen in Tourismusregionen grösser geworden ist. Die Wahrnehmung der Landschaft mit Energieanlagen (Landscape-Technology-Fit) beeinflusst Präferenzen, ist aber über die Zeit veränderbar. Mögliche Standorte hängen auch von Gesetzen (z.B. Waldgesetz oder Fruchtfolgeflächen) ab.

Viele Veränderungen in der Gesetzgebung
Bruno Röösli, Leiter der Arbeitsgruppe Waldrecht der Konferenz der Kantonsförster (KOK), präsentierte in Vertretung von Thomas Abt die rechtlichen Rahmenbedingungen. Das Schweizer Stimmvolk sagte im vergangenen Juni klar Ja zum Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Neu gelten Windenergieanlagen und ihre Erschliessungswege im Wald grundsätzlich als standortgebunden, wenn sie von nationalem Interesse sind und bereits eine strassenmässige Erschliessung im Sinne einer forstlichen Strasse besteht. Rodungsbewilligungen sind weiterhin notwendig. Die verschiedenen Rodungskriterien wie die Voraussetzungen der Raumplanung müssen erfüllt sein, dazu haben die Kantone Eignungsgebiete für Windenergie in Richtplänen auszuscheiden. Die Festsetzung erfolgt auf der Basis einer breiten Interessenabwägung, die sämtliche Grundlagen, insbesondere im Bereich des Arten- und Landschaftsschutzes sowie der Walderhaltung und des Kulturlandschutzes inklusive Fruchtfolgeflächen, einbezieht.
Die Rolle der erneuerbaren Energien für die Sicherstellung der Versorgung fasste Saskia Bourgeois von der Sektion Erneuerbare Energien des Bundesamts für Energie (BFE) zusammen: Vor dem Hintergrund, dass das Schweizer Volk 2023 mit dem Klima- und Innovationsgesetz das Netto-Null-Ziel bis 2050 beschlossen hat, müssten auch sämtliche inländische Potenziale für die Produktion erneuerbarer Energie ausgenutzt werden. Die Windenergie leistet einen Beitrag zur Deckung der Winterstromlücke.
Naturschutz, Wirtschaftlichkeit, Innovation und Produktion von erneuerbarer Energie müssten zusammenspielen, sagte Caspar Honegger, Leiter Amt für Wald und Naturgefahren im Kanton Nidwalden. In einer Grussbotschaft skizzierte Joe Christen, Landwirtschafts- und Umweltdirektor des Kantons Nidwalden, die Herausforderungen eines kleinen Kantons (Abbildung 3). Knapp 30 Prozent der Kantonsfläche sind bewaldet. «Die Schutzwirkung unserer Wälder ist von enormer Bedeutung», sagte Christen. Er unterstrich, dass im Kantonsleitbild 2035 weitere Massnahmen zur Risikosenkung geplant seien. Erholung und Wirtschaftlichkeit seien weitere Pfeiler. Strukturverbesserungsbeiträge und lnvestitionskredite von fast 4 Millionen Franken seien beträchtlich, würden aber Wertschöpfung in der Land- und Waldwirtschaft in einer Randregionen stärken und dazu beitragen, dass der kleine Kanton Nidwalden weiterhin sympathisch und erfolgreich sei.
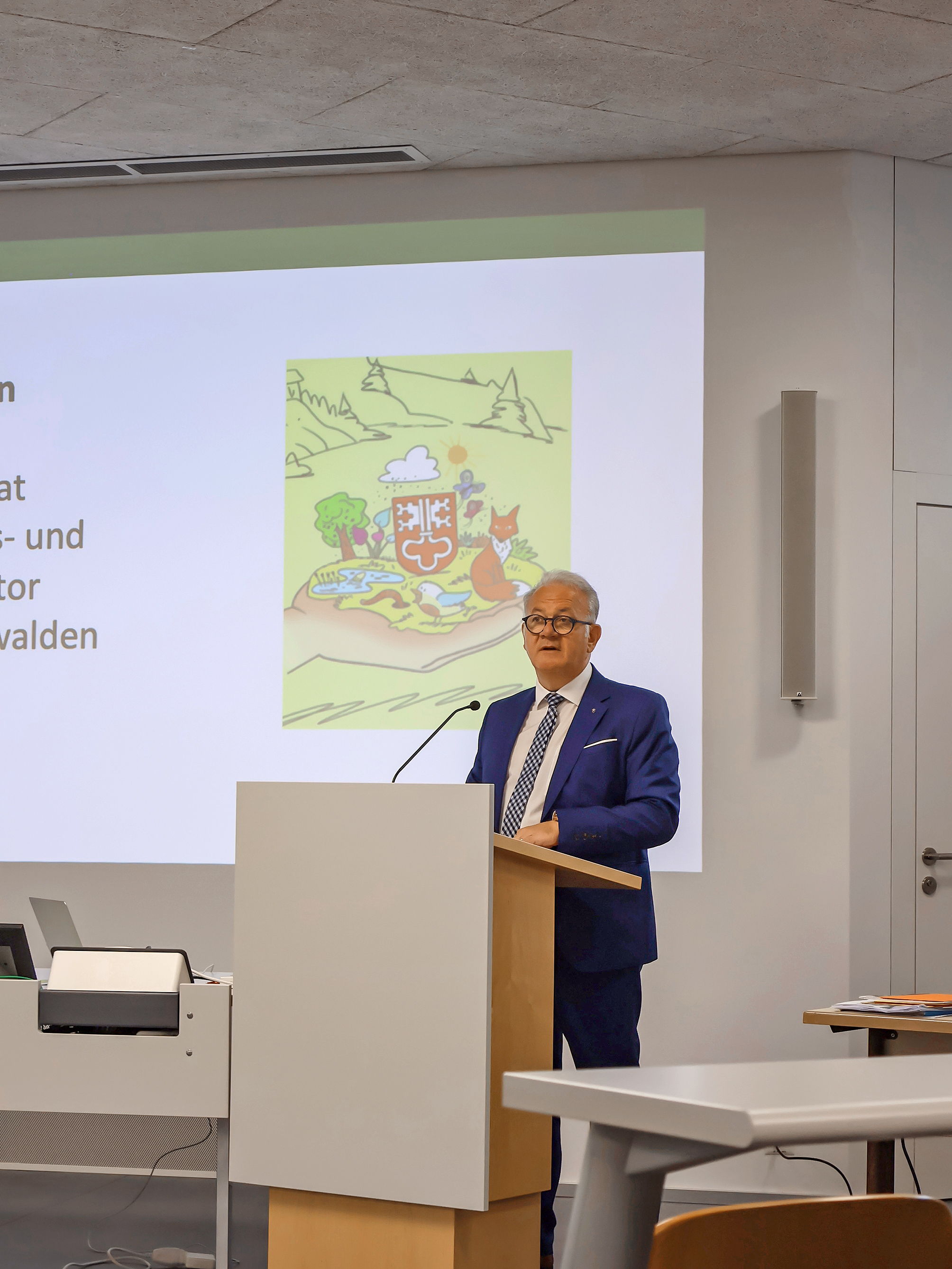
Sturm der Emotionen
«Zerstückelung von Lebensräumen» oder «Das 11. Gebot: Lasst den Wald in Ruhe»: Zum Start der Podiumsdiskussion fegte ein Sturm der Emotionen durch den Saal, der von Moderatorin Sonja Hasler gekonnt aufgefangen wurde (Abbildung 4a, 4b). Unter dem Titel «Erneuerbare Energien im Wald – reale Bedrohung oder Sturm im Wasserglas?» argumentierte anschliessend Elias Vogt, Präsident Freie Landschaft Schweiz und führende Kraft der Waldschutz-Initiative, für strikten Waldschutz. Auch Christa Glauser von BirdLife Schweiz setzte sich zugunsten des Umwelt- und Tierschutzes ein. In unterschiedlichen Rollen betonten sie die Folgen für die Natur beim Bau von Anlagen. Olivier Waldvogel von Suisse Eole, der Branchenvertretung für Windenergie, forderte die rasche Umsetzung von Windenergieanlagen, wo es möglich, sinnvoll und rentabel ist. Er sprach sich aber auch dafür aus, Synergien zu nutzen und Planung und Bau von Windanlagen im Dialog voranzutreiben. Saskia Bourgeois (BFE) und Bruno Röösli (KOK) erläuterten technische Entwicklungen der Windanlagen und naturräumliche und waldrechtliche Rahmenbedingungen.


Im süddeutschen Schliengen wurde kürzlich die Errichtung von Windkraftanlagen abgelehnt. Der dortige Bürgermeister Christian Renkert brachte seine Sicht ein, wie alle Ansprüche und Emotionen unter einen Hut zu bringen sind. Er schloss die Diskussion augenzwinkernd mit einem simplen Rezept: «Finde eine klimageschädigte Fläche im Wald mit Wind – und Windenergieanlagen werden möglich.» (Abbildung 5)

This Rutishauser
Das Seminar im Überblick: www.forstverein.ch > Downloads > Jahresversammlungen
Die Sicht der Arbeitsgruppen des SFV
AG Waldplanung und -management (WaPlaMa)
Waldplanerische Grundlagen bilden die fachliche Basis für die Interessenabwägung, dies gilt auch bei Entscheiden für den Beitrag des Waldes an nachhaltige Energieformen. Der ökologische, ökonomische und soziale Nutzen unter Einbezug aller Waldleistungen muss sämtlichen Massnahmen gegenübergestellt werden, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Neben der Windenergie leistet der Wald mit Energieholz einen Beitrag zur Produktion von erneuerbaren Energien. Zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel und an die steigende Energieholznachfrage müssen die Ressourcen nachhaltig genutzt werden. Holz soll primär stofflich und nicht energetisch genutzt werden (Kaskadennutzung, Kreislaufwirtschaft).
AG Waldbiodiversität
Die Sorgenkinder der Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die Waldbiodiversität sind Vögel und Fledermäuse. Beim Bau von Anlagen entsteht ein (temporärer) Verlust von Waldfläche und Lebensraum, und es kommt zu Störungen während der Bauzeit. Während des Betriebs verursachen Unterhalt und Zufahrtswege Störungen. Für migrierende Arten führen Windenergieanlagen zur Zerschneidung von Flugrouten und Kollisionen. Lokale Arten verlieren Lebensraum und sind ebenfalls kollisionsgefährdet. Im Ökosystem Wald sind die meisten Arten weniger an regelmässige oder häufige Störungen angepasst als im Offenland. Die Langzeitwirkungen dieses Stresses sind noch wenig bekannt. Für einige Fledermaus- und Vogelarten kann die Errichtung von Windenergieanlagen auch positive Folgen haben: Neu geschaffene Offenflächen nach Rodungen sind temporär attraktive Jagdreviere. Grundsätzlich sind Windkraftanlagen aus Biodiversitätssicht im Wald generell problematischer als im Offenland. Das Abschalten oder die Vertreibung von Tieren während der Aktivitäts-, Brut- oder Zugzeit vermindert die Schäden, was bei Fledermäusen gut klappen kann. Bei Vögeln lassen sich Schäden weniger einfach und kosteneffizient vermindern. Wichtig ist ein entsprechendes Monitoring mit genügend Mitteln.
AG Wald und Wildtiere
Die Stärkung der Holzenergie fördert die Pflege von Waldrändern und Hecken, was zu einer Lebensraumaufwertung führt. Während der Bauphase von Windkraftanlagen entstehen Störungen in ruhigen Waldgebieten und grossflächigere Beeinflussungen für störungsanfälligere Wildtiere (z.B. Raufusshühner, Rotwild). Die Erschliessung der Anlagen bringt mehr Freizeitstörung in den Wald und beeinträchtigt den Lebensraum von (seltenen) Vogelarten. Wasserkraftwerke beeinträchtigen tägliche und saisonale Wanderrouten und stören Vernetzungsachsen grossräumig. Windkraftanlagen können in unempfindlichen Lebensräumen erstellt werden, Störungen durch Fremdnutzungen sind zu verhindern. Sie sollen bevorzugt im Offenland stehen, da die Auswirkungen auf den Lebensraum geringer sind. Die Beeinträchtigung des Lebensraums ist bei der Interessenabwägung adäquat zu berücksichtigen.