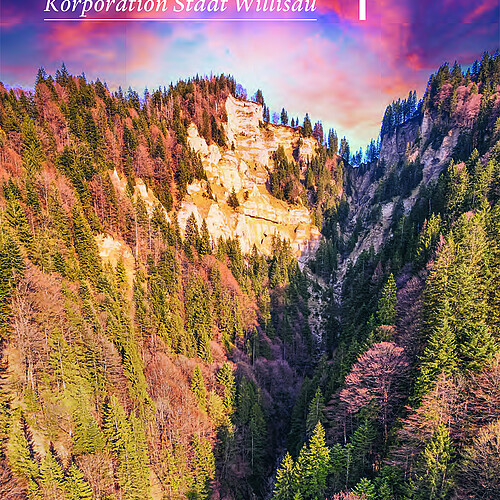- Aktuell
Kurznachrichten
26.02.2025

Wie Zukunftswald entsteht
Auf der Suche nach dem klimaangepassten Wald findet die Fachstelle Waldbau immer wieder «Best-Practice-Beispiele» – Inspiration, die zur Nachahmung anregen soll.
Die Anpassung des Waldes an den Klimawandel geschieht bisweilen ohne grosse und kostspielige Intervention des Menschen. Auf ihrer Webseite präsentiert die Fachstelle Waldbau inspirierende Fallbeispiele. Ihnen eigen ist als treibende Dynamik die Naturverjüngung und eine für Zukunftsbaumarten zielführende Verjüngungsökologie. Unterstützende Eingriffe sind nicht oder nur in verhältnismässig geringem Umfang nötig. Es werden bereits zehn Beispiele aus sechs Kantonen dokumentiert, inklusive Diskussion der Faktoren, die zum Erfolg des Transformationsprozesses beitragen. Mit der Zeit soll ein Kompetenzzentrum für Naturverjüngung und naturnahen adaptiven Waldbau entstehen.
waldbau-sylviculture.ch

Baumwurzeln wachsen auch im Winter
Wenn im Herbst die Blätter fallen, stellen die Stämme von Laubbäumen in den gemässigten Zonen Westeuropas ihr Wachstum ein. Die Wurzeln aber wachsen entgegen bisherigen Annahmen den ganzen Winter hindurch weiter. Zu diesem Schluss kommt eine von der Universität Antwerpen geleitete Studie mit WSL-Beteiligung. Für ihre Untersuchungen haben die Forschenden rund 1000 Wurzelproben von 300 Bäumen in Belgien, Norwegen und Spanien entnommen. Sie erhoffen sich von ihren Erkenntnissen präzisere Vorhersagen über die Kohlenstoffspeicherung und die Walddynamik.
9.1.2025, wsl.ch
Klimaleistung des Waldes berechnet
Der Beitrag des Aargauer Waldes an das angestrebte Klimaziel «Netto-Null bis 2050» beträgt im besten Fall 3.7 Prozent der heutigen jährlichen Emissionen im Kanton. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Kantons Aargau, die verschiedene Szenarien modelliert hat. Das optimale Szenario geht von einem Zuwachs des Holzvorrats im Wald und einer besseren Kaskadennutzung des Holzes aus. Bis ins Jahr 2100 könnten so 11.1 Millionen Tonnen CO2 gespeichert und eingespart werden. Unter Berücksichtigung des durch den Klimawandel reduzierten Holzwachstums sind es 9.4 Millionen Tonnen oder 3.1 Prozent der heutigen Emissionen.
3.12.2024, Newsletter Kt. AG
Globale Entwaldung durch Schweizer Importe
Die Schweizer Importe und der Konsum von Soja, Rindern (Fleisch und Leder), Palmöl, Kakao, Kaffee, Naturkautschuk, Holz und deren Erzeugnissen führen zu einem jährlichen Verlust von rund 4300 Hektaren tropischer Wälder – was etwas mehr ist als die Fläche des Bielersees. Zu diesem Resultat kommt eine Studie der BFH-HAFL im Auftrag des BAFU. Die Forschenden stützen ihre Schätzung auf die in der Schweizerischen Aussenhandelsstatistik erfassten Importe. Die Erkenntnisse der Studie sollen die Schweiz bei der Bekämpfung der Entwaldung und den Bemühungen zur Förderung entwaldungsfreier Lieferketten unterstützen.
bit.ly/CH-Import-Entwaldung
Baumeister des Waldbodens
Die Untersuchung der Aktivitäten von zwei Wurmarten bringt neue Erkenntnisse zum Einfluss der unscheinbaren Tiere auf die Kohlenstoffflüsse im Waldboden.
Waldböden speichern mehr Kohlenstoff als die darauf wachsende Pflanzenbiomasse. Eine wichtige, aber noch weitgehend unerforschte Rolle spielen dabei Würmer, die organisches Material in den Boden ziehen und Mikroorganismen fressen. Wie der Prozess genau abläuft, ist Gegenstand des schweizerisch-deutschen Forschungsprojekts Forest Floor. In seiner Doktorarbeit an der Forschungsanstalt WSL hat Phillip de Jong das Wirken des verbreitet vorkommenden Tauwurms und des bläulichen Wurms in der Rendzina, dem Boden des Jahres 2025, studiert. Es zeigte sich, dass weniger des aus dem Laub stammenden Kohlenstoffs wieder in die Atmosphäre geht, wenn beide Wurmarten zusammenleben.
5.12.2024, wsl.ch

PSM-Fachbewilligung: 2027 nur noch digital
Wer im Wald Pflanzenschutzmittel (PSM) verwendet, braucht ab 2027 die neue, digitale Fachbewilligung (FaBe-W). Sie kann alle fünf Jahre verlängert werden, wenn der Nachweis einer Weiterbildung erbracht wird. Die entsprechende Verordnung des Bundes tritt 2026 in Kraft. Sie ersetzt jene von 2005 und beinhaltet auch ein neues Prüfungsreglement. Wer bereits eine FaBe-W hat, kann diese 2026 prüfungsfrei gegen eine digitale eintauschen. Die dazu erforderliche App ermöglicht dem Handel auch zu kontrollieren, wer welche PSM erwerben darf.
permis-pph.admin.ch
Am Puls der Trends von Urban Forestry
«Urbane Wälder für widerstandsfähige und gesunde Städte» lautet das Thema des 27. European Forum on Urban Forestry. Es findet dieses Jahr vom 3. bis 7. Juni in Zürich statt. Hauptzweck ist wie immer der Austausch über Trends und Erfahrungen zwischen Fachleuten und Interessierten aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Praxis. Organisiert wird der Kongress von der Stadt Zürich, der ETHZ, der WSL, der BFH-HAFL, dem Waldlabor Zürich und ArboCityNet.
efuf.org
Schattenreich voller Geheimnisse
«Pöschelibock, Waldteufel und Laubsack» heisst die aktuelle Sonderausstellung im Museum Appenzell, bei der sich alles um den Wald dreht. Sie nähert sich dem Thema aus volkskundlicher und kulturhistorischer Sicht und beleuchtet auch Aspekte der traditionellen Waldnutzung. Als «Erholungsort, Schattenreich voller Geheimnisse und Rohstofflieferant» hat der Wald auch zeitgenössische Kunstschaffende inspiriert, deren Werke ebenfalls zu sehen sind. Die Ausstellung dauert noch bis zum 7. September 2025.
museum.ai.ch
Fragen zum Wald? INForest weiss Antwort
Wieviel oberirdische Biomasse enthält eine Hektare Wald in Finnland? Wie hat sich das Verhältnis zwischen öffentlichem und privatem Waldbesitz in Italien seit 1990 verändert? Und wie hoch ist der Wert der von der Schweiz exportierten Forsterzeugnisse zwischen 1964 und 2022? Solche und viele weitere Fragen beantwortet die neue Plattform INForest der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (UNECE). Verfügbar sind Daten und Information aus dem ganzen UNECE-Gebiet. Dieses umfasst 56 Mitgliederländer des globalen Nordens in Europa, Asien und Nordamerika.
forest-data.unece.org
«Lothar» förderte gefährdete Insekten
Wo vom Sturm gefällte Bäume liegen bleiben, erhalten gefährdete Insektenarten eine neue Chance. Das zeigt eine WSL-Studie, die den Insektenbestand von 16 durch Vivian (1990) und Lothar (1999) verursachten Sturmflächen 20 Jahre lang untersucht hat. Wo das Sturmholz liegenblieb, fanden sie zwar nicht mehr Arten als auf geräumten Flächen. Hingegen kam jede fünfte Art nur hier vor – darunter gefährdete Arten wie der Grosse Zangenbock oder die Mauerbiene. Im Rahmen der Studie wurden rund 500 000 Individuen von über 1600 Arthropoden-Arten gesammelt.
30.1.2025, wsl.ch